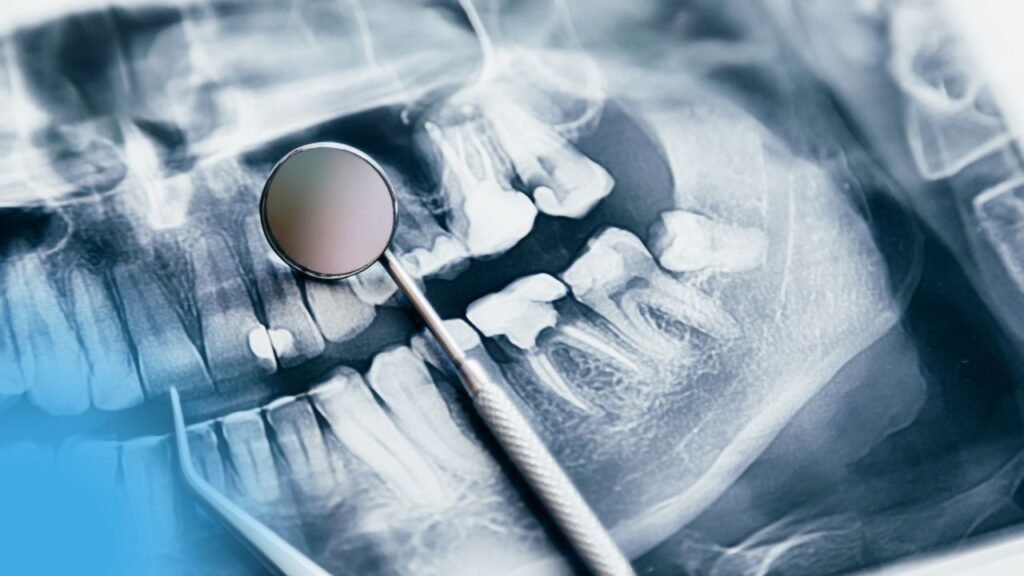Behandlung von Patienten unter zielgerichteten Therapien
- Einführung
Zielgerichtete Therapien haben die Behandlung bestimmter Erkrankungen in den letzten Jahren grundlegend verändert.
Dabei handelt es sich um Behandlungen mit biologischen Produkten, im Gegensatz zu synthetischen Chemotherapiemolekülen.
Tatsächlich sind diese Therapien nicht ohne Nebenwirkungen und der Zahnarzt muss sich daher ihrer möglichen Auswirkungen auf die Mund- und Zahngesundheit bewusst sein.
- Definition
– „Zielgerichtete Therapien“ sind Behandlungen, die sich gegen molekulare Ziele (Rezeptoren, Gene oder Proteine) richten.
-Sie haben den Vorteil, dass sie weniger toxisch sind, da sie gesunde Zellen schonen, und ermöglichen eine individuelle Behandlung entsprechend der Pathologie und Molekularbiologie des Patienten.
-Gezielte Therapien können auf verschiedenen Ebenen der Zelle wirken:
- auf Wachstumsfaktoren (das sind Botenstoffe, die die Informationsübertragung innerhalb einer Zelle auslösen),
- an ihren Rezeptoren (die die Übertragung von Informationen innerhalb der Zelle ermöglichen)
- auf Elementen innerhalb von Zellen.
Behandlung von Patienten unter zielgerichteten Therapien
- Je nach Art des verwendeten Moleküls unterscheiden wir:
– monoklonale Antikörper , die mit den Liganden von Membranrezeptoren oder mit dem extrazellulären Teil des Rezeptors interagieren, indem sie die Bindung des Moleküls verhindern. Sie haben das Suffix „mab“. Sie werden intravenös verabreicht.
– Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs). Dabei handelt es sich um kleine Moleküle, die in die Zelle eindringen und dort Signalwege hemmen, indem sie auf den intrazellulären Teil der Rezeptoren einwirken. Sie tragen die Endung „Nib“ und werden oral verabreicht.
Zielgerichtete Therapiemoleküle können auch nach ihrer Wirkungsweise klassifiziert werden. Wir unterscheiden daher:
- Anti-Angiogenese
– HER-Inhibitoren (Herceptin)
– Inhibitoren des KIT, eines Membranrezeptors
- mTOR-Inhibitoren (mechanistisches Ziel von Rapamycin)
- Zytokin
- 3. Anwendungsgebiete
- Einsatz in der Rheumatologie
| Therapeutischer Unterricht | Generischer Name | Handelsname | Art und Häufigkeit der Nutzung | Anzeige |
| AntiTNF | Infliximab | Remicade | 3 mg/kg bis 10 mg/kg i.v. alle 6 bis 8 Wochen | Rheumatoide Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Psoriasis-Arthritis, entzündliche Darmerkrankung, Psoriasis |
| AntiTNF | Etanercept | Enbrel | 50 mg subkutan jede Woche | Rheumatoide Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Psoriasis-Arthritis, juvenile idiopathische Arthritis, Psoriasis |
| AntiCD20 | Rituximab | Rituxan | 1 g intravenös 2 Dosen und danach nach Bedarf | Rheumatoide Arthritis, Non-Hodgkin-Lymphom, chronische lymphatische Leukämie, Wegener-Granulomatose, mikroskopische Polyangiitis |
- Indikation in der Inneren Medizin
- Systemischer Lupus erythematodes
- Sarkoidose: Wirksamkeit von Anti-TNF bei refraktären und schweren Formen
- Primäre oder sekundäre nekrotisierende Vaskulitis
- Morbus Behçet als Erstlinienbehandlung, insbesondere bei Augen-, neurologischen oder Verdauungsbeschwerden
- Indikation in der Neurologie: Der Einsatz von Natalizumab, Interferon-b 1a und 1b bei Multipler Sklerose
4-Orale Manifestationen zielgerichteter Therapien
- Mukositis/Aphthengeschwüre: Zahlreiche gezielte Therapien können eine Entzündung der Mundschleimhaut hervorrufen. Die beobachteten Läsionen unterscheiden sich jedoch sehr deutlich von der durch Chemotherapie verursachten Mukositis, sie erscheinen in ihrer Größe viel begrenzter und nehmen häufig ein ulzeriertes, aphthoides Aussehen an.
Die funktionellen Auswirkungen können jedoch mitunter erheblich sein und ein Einschränken oder sogar ein vorübergehendes Absetzen der Krebsbehandlung erforderlich machen.
- Die Behandlung dieser Läsionen basiert auf symptomatischen Maßnahmen, die heute noch nicht streng kodifiziert sind. Hierzu sollten zumindest eine prätherapeutische Mundhygiene-Rehabilitation, eine strenge Mundhygiene-Schulung und die mehrmalige tägliche Anwendung milder Mundspülungen (Natriumbikarbonat) gehören.
- Lichenoide Reaktionen:
Sie werden hauptsächlich mit Imatinib, BCR-ABL (Philadelphia-Gen oder Ph1-Chromosom) und c-Kit assoziiert.
Klinisch unterscheiden sich diese lichenoiden Reaktionen nicht von den beim Lichen ruber planus beobachteten Reaktionen und sind mit retikulären Läsionen, Atrophie und entzündlichen Ulzerationen verbunden.
Betroffen sind vor allem die Wangenschleimhaut und die Zunge.
Die therapeutische Behandlung basiert auf einer lokalen Kortikosteroidtherapie und eine gezielte Behandlung kann aufrechterhalten werden.
- Sekundäre Hyperkeratosen:
Die fortschreitende Entwicklung hyperkeratotischer intraoraler Läsionen betrifft nur Serin-Threonin-Kinase-Inhibitoren, die auf BRAF (B-raf-Proto-Onkogen) abzielen.
Diese Läsionen führen zu einer homogenen Hyperkeratose, die vor allem an der Linea alba, den seitlichen Rändern der Zunge, dem harten Gaumen und der marginalen Gingiva auftritt.
- Geografische Sprachen
Moleküle mit antiangiogenetischer Aktivität, d. h. solche, die auf VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) oder dessen Rezeptoren abzielen, können die Entwicklung einer gutartigen Wanderglossitis oder Landkartenzunge fördern.
Das klinische Erscheinungsbild ist mit dem der idiopathischen Landkartenzunge durchaus vergleichbar, d. h. es treten entpapillierte Bereiche auf, die von einem erhabenen serpiginösen Rand umgeben sind.
Die Behandlung beruht lediglich darauf, dem Patienten zu versichern, dass diese Läsionen absolut gutartig sind. Die Krebsbehandlung kann fortgesetzt werden.
- Dysgeusie:
Eine Geschmacksveränderung kann auch mit der Einnahme verschiedener gezielter Therapien einhergehen.
Es tritt besonders häufig bei Sunitinib auf, wurde aber auch bei Anti-EGFR (epidermaler Wachstumsfaktor) berichtet.
- Osteochemonekrose:
Gezielte anti-angiogene und anti-responsive Therapien können eine Osteonekrose des Kiefers auslösen.
- Unterstützung
- A) Prävention vor Therapieeinführung :
- Eine gründliche klinische Untersuchung, ergänzt durch einen zahnärztlichen Panoramascan, stellt die Mindesterstuntersuchung dar.
- Beseitigung aktiver oder potenzieller Infektionsherde durch Extraktion von Zähnen mit parodontalen oder endodontischen Läsionen oder tiefer Karies.
- Wenn zuvor invasive Zahnbehandlungen, wie zum Beispiel Extraktionen, durchgeführt wurden, muss eine Heilungsphase von mindestens 15 Tagen eingehalten werden, bevor mit der Behandlung mit der zielgerichteten Therapie begonnen wird.
- Wenn der Patient eine antiangiogene Behandlung mit Bevacizumab oder Sunitinib erhalten soll, sollte er über das mögliche Risiko der Entwicklung einer Osteochemonekrose des Kiefers informiert werden.
- Behandlung von Parodontalerkrankungen
- Versiegelung bestehender Zahnrestaurationen
- Wiederaufnahme von Pflegemaßnahmen mit scharfen oder schneidenden Kanten, die die Schleimhäute reizen könnten
- Motivation zur Mundhygiene mit Schwerpunkt auf Putzmethoden
- Gesunder Lebensstil und Ernährungsberatung durch Raucherentwöhnung und Vermeidung von scharfen Speisen, die zu heiß oder zu kalt sind.
- B) Unterstützung während der Behandlung mit zielgerichteter Therapie:
- Vorsichtsmaßnahmen bei nicht-chirurgischer Behandlung
Für diese Art der Behandlung gibt es keine Kontraindikationen und eine Modulation der Behandlung durch gezielte Therapie ist nicht erforderlich.
Laut AFSSAPS wird bei invasiven Eingriffen eine Antibiotikaprophylaxe empfohlen
- Vorsichtsmaßnahmen bei der chirurgischen Versorgung
- Wenn bei Patienten unter zielgerichteter Therapie ein chirurgischer Eingriff in Betracht gezogen wird, muss besonders auf das mögliche Auftreten von postoperativen Blutungen und Infektionen geachtet werden, insbesondere auf OCN bei Patienten, die antiangiogene Wirkstoffe wie Bevacizumab (Avastin) oder Sunitinib (Sutent) einnehmen.
- Es ist daher notwendig, den Patienten zu informieren und hinsichtlich des einzuhaltenden Verhaltens wachsam zu sein.
- Vor der Durchführung eines chirurgischen Eingriffs wird ein Abbruch der zielgerichteten Therapie empfohlen.
- Die Methoden zur Unterbrechung der Behandlung variieren je nach Molekül:
- monoklonale Antikörper: 2 bis 3 Wochen vor dem Eingriff absetzen
- ITK: 5 bis 7 Tage vor dem Eingriff absetzen.
Die Behandlung wird nach Abschluss der Schleimhautheilung und mit Zustimmung des Onkologen fortgesetzt.
- Betriebsprotokoll
– unter Antibiotika-Abdeckung: Die Behandlung wird 48 Stunden vor der Operation begonnen und bis zur Heilung (ca. 15 Tage) fortgesetzt;
– sorgfältige Desinfektion des Operationsfeldes, Spülung mit Chlorhexidin
– lokale oder lokoregionale Anästhesie: Vermeidung einer intraligamentären Anästhesie
– atraumatische Chirurgie
– Regulierung der Alveolarprozesse
– lokale blutstillende Mittel (intraalveoläres resorbierbares Material)
– wasserdichte Nähte
– mögliche Verwendung von biologischem Klebstoff
– postoperative Beratung
– Heilungskontrolle.
- Sonderfall
- Anti-TNF
- In der Praxis schlagen wir für Patienten, die Anti-TNF einnehmen und als immungeschwächt gelten, Folgendes vor:
• Bei nichtinvasiven Eingriffen (z. B. unblutige Präventivmaßnahmen, konservative Behandlung, unblutige Prothesenbehandlung, postoperative Nahtentfernung, Einsetzen herausnehmbarer Prothesen, Anpassen oder Korrektur kieferorthopädischer Geräte, zahnärztliche Röntgenaufnahmen usw.) ist eine prophylaktische Antibiotikatherapie nicht angezeigt und ein Absetzen der Anti-TNF-Behandlung nicht gerechtfertigt.
• Bei invasiven Eingriffen (die wahrscheinlich eine lokale, entfernte oder allgemeine Infektion verursachen) wird normalerweise eine prophylaktische Antibiotikatherapie empfohlen.
Das Absetzen von Anti-TNF sollte unter den gleichen Bedingungen erfolgen, die bei chirurgischen Eingriffen mit geringem Infektionsrisiko empfohlen werden.
• Zur Zahnsteinentfernung bieten wir eine prophylaktische Antibiotikatherapie ohne Absetzen des Anti-TNF an.
Dauer des Absetzens von Anti-TNF-Alpha vor der Operation:
- Etanercept: mindestens 2 Wochen
- Infliximab: mindestens 4 Wochen
- Adalimumab: mindestens 4 Wochen
- Rituximab
Eine regelmäßige Mundhygiene und Pflege ist empfehlenswert. Bei schlechter Mundgesundheit sollte vor Beginn der Behandlung mit Rituximab eine entsprechende Pflege erfolgen.
▷ Übliche Pflege (Karies, Zahnsteinentfernung): Eine antibiotische Prophylaxe kann angeboten werden.
▷ Behandlung bei Infektionsrisiko (Extraktion, apikales Granulom, Abszess etc.): Unterlassen der 2. Rituximab-Infusion, wenn die Behandlung zwischen 2 Infusionen erfolgen muss.
- Meistens kann die Einnahme des Medikaments jedoch nicht unterbrochen werden, da der Zyklus aus zwei Infusionen bereits seit mindestens sechs Monaten durchgeführt wurde und Auswirkungen auf die Immunität hat. Dann empfiehlt sich eine antibiotische Prophylaxe.
▷ Implantate: Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, Sie sollten jedoch hinsichtlich des möglichen Auftretens von Infektionen wachsam bleiben.
Abschluss
- Dem Zahnarzt kommt daher eine Schlüsselrolle bei der Vorbeugung und/oder Behandlung oraler und zahnmedizinischer Folgeschäden infolge gezielter Therapien zu. Aus diesem Grund ist die Betreuung der Patienten durch ihren Zahnarzt vor, während und nach der Krebsbehandlung so wichtig.
- Das Hauptziel besteht darin, das Auftreten von Komplikationen im Zusammenhang mit diesen Behandlungen zu verhindern und so die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
Bibliographische Referenzen
- Vincent Sibaud, Emmanuelle Vigarios. Orale Toxizität gezielter Krebstherapien. Med Buccale Chir Buccale 2015;21:149-155.
- Französische Agentur für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten (AFSSAPS). Verschreibung von Antibiotika in der zahnärztlichen Praxis. Juli 2011.
- Empfehlungen der französischen Gesellschaft für Oralchirurgie (SFCO). Behandlung oraler und dentaler Infektionsherde.2012
- Pauline Tamburini. Zahnärztliche Verordnungen und Vorsichtsmaßnahmen für Patienten, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen. Dissertation: Chir-Dent: Nancy: 2015.
- Petit Emilie. Zielgerichtete Therapien bei der Behandlung von Krebserkrankungen: orale und dentale Nebenwirkungen und Management in der Zahnmedizin. Dissertation: 3. Zyklus sci.odontol.: Straßburg: 2016; Nr. 48.
- Cynthia-Pierre. Regeln für die Verschreibung von Antibiotika in der Oralchirurgie. Th.: Zahnarztchirurgie : Nancy 2018.
- Rheuma- und Entzündungsclub. Praktische Blätter. http://www.cri-net.com (abgerufen am 04.02.2023).
Behandlung von Patienten unter zielgerichteten Therapien
Behandlung von Patienten unter zielgerichteten Therapien
Behandlung von Patienten unter zielgerichteten Therapien
Milchzähne müssen gepflegt werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Durch eine Parodontitis können Zähne locker werden.
Herausnehmbarer Zahnersatz stellt die Kaufunktion wieder her.
In der Praxis angewendetes Fluorid stärkt den Zahnschmelz.
Gelbe Zähne können mit einem professionellen Bleaching behandelt werden.
Zahnabszesse erfordern oft eine Behandlung mit Antibiotika.
Eine elektrische Zahnbürste reinigt effektiver als eine Handzahnbürste.